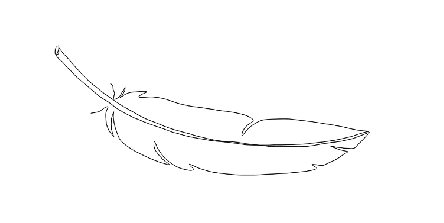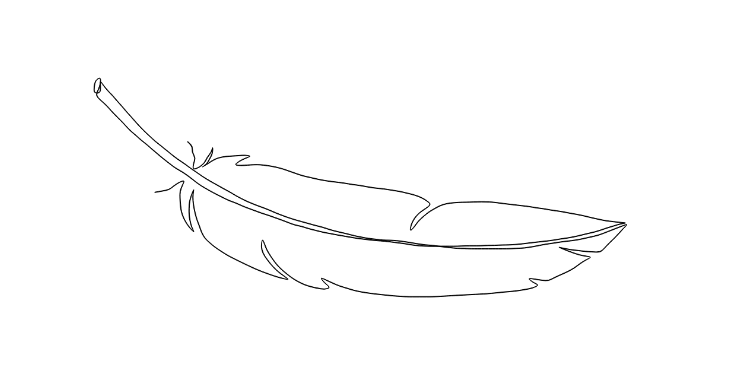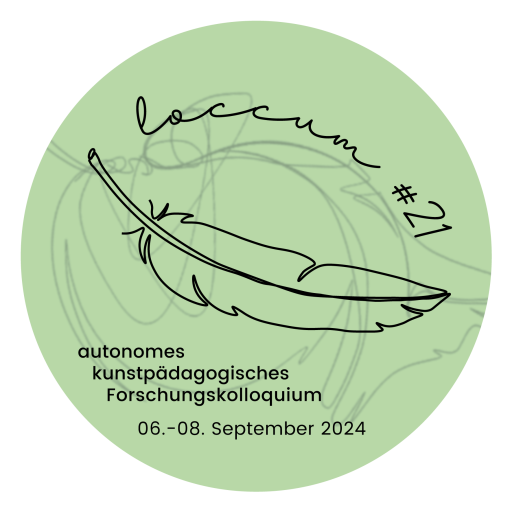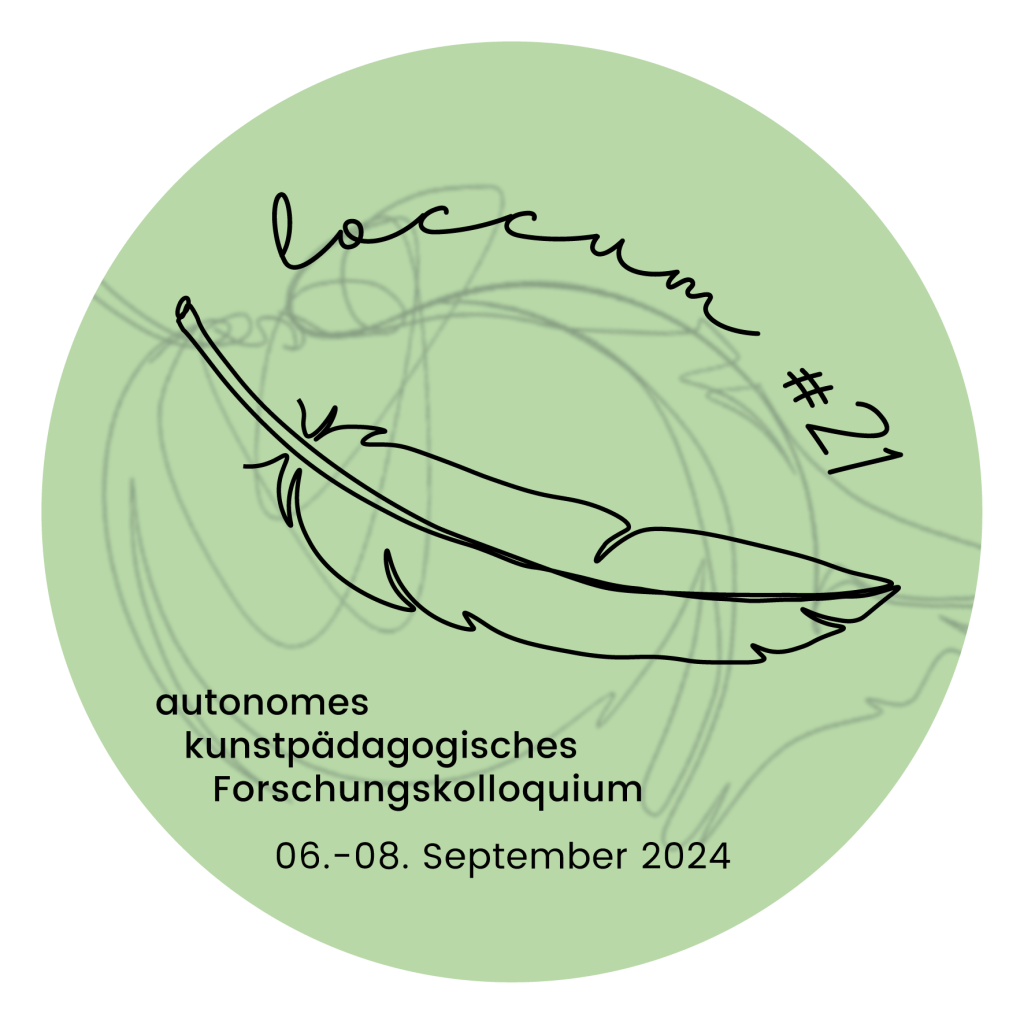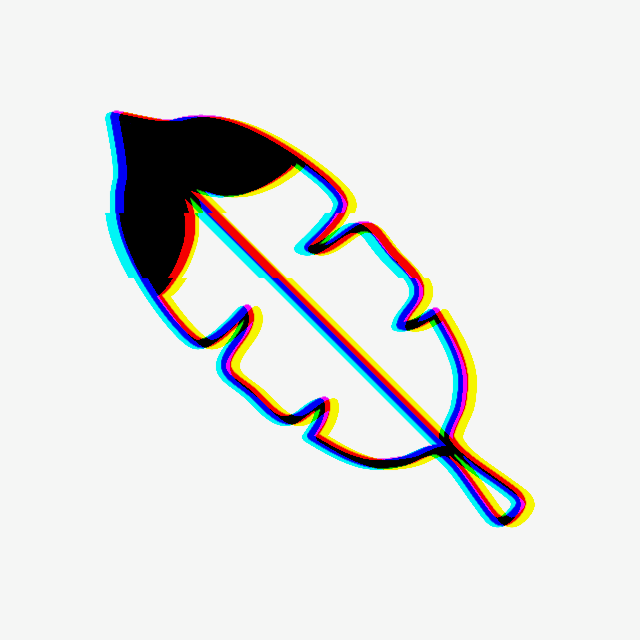»Bewegung ist, phänomenologisch betrachtet, der
Vermittler zwischen Mensch und Welt, das Medium,
mit dem und über das der Mensch die Welt erfasst.«
KLEIN 2012/2013, o. S.
»Ruhe bedeutet […] keinen Mangel an Bewegung, sondern
deren Quelle; sie verhindert, dass die allgemeine Bewegung
in regellose Einzelbewegungen auseinanderstiebt.«
WALDENFELS 2007, S. 15
Bewegung im weitesten Sinne ist die Voraussetzung für jede Form der Veränderung. Egal ob im Forschungsprozess, in der kunstdidaktischen Arbeit, in der künstlerischen Praxis oder im Privaten – nur durch Bewegung kommen Prozesse in Gang und werden schließlich produktiv. Ist man erstmal so richtig in Bewegung, ist man ganz bei der Sache. Man hat sich dem Vorhaben ganz verschrieben und es „fließt“ einfach. Es geht voran – mal im Dauerlauf, mal in einzelnen Sprüngen, mal mit kleineren Rückschritten. Manchmal hat man aber auch eher das Gefühl, sich mühsam abzustrampeln, ohne sich wirklich vorwärts zu bewegen oder man ist wie festgefroren und Bewegung selbst scheint unerreichbar.
Stillstand – Frustration – Stagnation.
Dabei vergessen wir oft, dass Fortschritt nicht immer nur bedeutet, sich laufend nach vorne zu bewegen. Auch Schleifen, größere Umwege und Stille gehören zu natürlichen und lebendigen Bewegungsprozessen dazu. Wo finden wir die für Bewegung so notwendige Ruhe? Was in unserem beruflichen und persönlichen Alltag bewegt sich warum, wie und wohin? Wie kommen wir in Bewegung, wenn wir sie gerade brauchen?
»Neben politischen Themen der freiwilligen und unfreiwilligen Bewegung von Individuen und ganzen Menschengruppen findet Bewegung auch in unserer Sprachkultur statt. Sprachen leben von ihren Körperbewegungen im Sprechfluss, Gebärden bilden Konzepte, Ideen, Gefühle, Erfahrungen, Beziehungen. Und schauen wir in unseren Berufsalltag als Nachwuchswissenschaftler*innen, finden wir uns im Wechsel von stillen und bewegten Momenten wieder. Achtsamkeit umfasst nicht mehr nur die Yogastunde am Mittwochabend, sondern auch unsere Fitness und täglichen Entscheidungen, die wir für unsere Gesundheit treffen. Achten wir auf unseren Körper und denken ihn in jeder Entscheidung mit?« – MARIE
»In der Kunst tanzt Bewegung auf vielen Bühnen. Performance, Tanz und Theater verweben Körper und Raum, Bewegtbilder dokumentieren den Fluss der Zeit, die Hände der Kunstschaffenden sind Dirigenten, die Ideen in formgewordene Harmonien verwandeln. Bewegung und Stille ergeben ein vertrautes Tanzpaar: der künstlerische Prozess ist ein ständiges Wechselspiel zwischen dynamischem Tatendrang und stiller Versunkenheit, im Theater entfaltet sich Bewegung in den Aktionen der Schauspielenden, während die Ruhe in den Pausen durch die Ränge haucht, in geschwungenen Linien des Materials wiegt sich die Skulptur, die ewig in Regungslosigkeit verharrt. Bewegung und Stille werden zu einer Choreografie, die sich in jedem Pinselstrich, jeder Drehung und jedem virtuellen Schritt entfaltet.« – KATRINA
»Jeder Forschungsprozess ist von Beginn bis Ende ein Prozess in Bewegung. Dabei haben wir die immanenten Dynamiken nicht immer unter Kontrolle: manchmal verändern sich die Bedingungen unvorhersehbar und manchmal gerät der Prozess auch ungewollt ins Stocken. Zudem ist die Kunstpädagogik eine ohnehin schon recht agile Wissenschaft, die sich wendig zwischen den Stühlen verschiedener Disziplinen hin- und herbewegt und die begleitet wird von der Notwendigkeit, die eigene Legitimation zu sichern. Wir Forschenden finden uns oft in einem Prozess zwischen Getriebenwerden, Stillstand und eigenem Antrieb wieder, in dem wir Flexibilität bewahren und gleichzeitig Standfestigkeit entwickeln müssen.« – MELINA
»Freitag 13 Uhr. Du bist erschöpft. Stillstand. Nichts geht mehr. Fast nichts. Du schleppst dich zum Lehrer*innen-Schüler*innen-Sport. Dort laufen zehn Burn-Out gefährdete Kolleg*innen und elf muntere Jugendliche einem Ball hinterher. Dabei passiert etwas Seltsames. Obwohl du mit Minus-Energie ankommst, gehst du energetisch und belebt ins Wochenende. Wie kann das sein? Hartmut Rosa begründet dieses Phänomen damit, dass soziale Energie keine individuelle Ressource, sondern eine kollektive Kraft sei. „Sie existiert nur in der Bewegung, sie ist zirkulierende Energie – sobald wir sie haben wollen, verschwindet sie. […] Sie ist etwas, an dem wir und alle Beteiligten partizipieren, demgegenüber wir uns öffnen oder verschließen können“ (Rosa 2024, S. 47). Die Kunstdidaktik könnte sich als Expertin im Kreieren einer zirkulierenden, sozialen Energie erweisen. Von welchen Faktoren hängt es ab, ob eine offene und partizipative Bewegung zwischen den Beteiligten in Gang kommt? Wie gelingt es, die einzelnen Lehrenden und Lernenden dazu zu befähigen, für sich mit dem Material in einen ruhigen und konzentrierten Bewegungszustand zu kommen? Und wie müssen wir auch die Übergänge zwischen den beteiligten Institutionen und partizipierenden Personengruppen neugestalten, um eine kunstpädagogische Bewegung zu formen?« – JONAS
FORMELLES
Wir möchten euch im Rahmen des 21. Autonomen Kunstpädagogischen Forschungskolloquiums Loccum vom 06.-08.09.2024 herzlich dazu einladen, unter dem übergreifenden Thema LOCCUM #21 IN BEWEGUNG über alles Bewegliche und Unbewegliche in den Austausch zu treten.
Das Forschungskolloquium ist ein geschützter Rahmen, in dem wir uns neugierig begegnen, gemeinsam an Themen herantasten und wertschätzend diskutieren. Hier können wir uns mit Forschungsfragen, -prozessen und -ergebnissen auseinandersetzen sowie fachliche Beziehungen knüpfen.
Der Austausch findet sowohl in der großen Gruppe als auch in kleineren Arbeitsgruppen statt. Ihr habt jeweils ein 60-minütiges Zeitfenster, das ihr nach eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen nutzen könnt. Dies kann z. B. ein Vortrag, eine Diskussionsrunde, eine Lecture Performance, ein Workshop oder ähnliches sein. Wir wollen uns übergreifend mit folgenden Fragen auseinandersetzen:
- Was ist bei eurem Forschungsvorhaben wie und warum in Bewegung?
- Was soll in Bewegung gebracht oder angehalten werden?
- Was soll beschleunigt oder verlangsamt werden?
- Was bewegt euch ganz persönlich?
Eine explizite thematische Bezugnahme auf den Call hinsichtlich der eigenen Forschungsarbeit ist wünschenswert, aber keine Voraussetzung zur Teilnahme.
Das Kolloquium richtet sich vor allem an Nachwuchswissenschaftler*innen (Promovierende und Post-Docs) aus den Bereichen Kunstpädagogik, Kunsttherapie, Kunsttheorie, Kulturelle Bildung sowie allen benachbarten Fachrichtungen aus dem deutschsprachigen Raum (u.a. Schweiz und Österreich). In der Atmosphäre eines Arbeitstreffens soll das Forschungskolloquium insbesondere die Gelegenheit bieten, mit anderen Nachwuchswissenschaftler*innen auf Augenhöhe zu diskutieren.
Wir möchten außerdem ausdrücklich darauf hinweisen, dass Loccum ein Ort für Fragmentarisches, Unreifes und Nicht-Ausformuliertes ist. Ihr seid herzlich willkommen, ganz egal wo ihr euch in eurem Forschungsprozess gerade bewegt!
TEILNAHME
Wir freuen uns über eine kurze Information zu deinem Forschungsprojekt und deinem geplanten Beitrag im Umfang von max. 3000 Zeichen (inkl. Leerzeichen).
Zusendung bis 31.05.2024 per Mail an: forschungskolloquium.loccum@gmail.com
Das Forschungskolloquium wird in der Evangelischen Akademie Loccum in 31547 Rehburg-Loccum stattfinden.
Die Tagungsgebühr (inkl. Übernachtung und Vollverpflegung) wird sich voraussichtlich auf 200€ pro Person belaufen.
Weitere Informationen folgen per E-Mail.
Euer Organisationsteam
Jonas Carr, Katrina Körner, Melina Maurer und Marie Wollert
Hier könnt ihr den Call herunterladen:
LITERATUR
Klein, Gabriele (2012/2013): Choreografien des Alltags. Bewegung und Tanz im Kontext Kultureller Bildung. Zugriff über:
https://www.kubi-online.de/artikel/choreografien-des-alltags-bewegung-tanz-kontext-kultureller-bildung
Rosa, Hartmut (2024): Social Battery: Was ist soziale Zeit? In: Die Zeit (3/24). Hamburg, S. 47.
Waldenfels, Bernhard (2007): Sichbewegen. In: Wulf, Christoph/ Brandstetter, Gabriele (Hrsg.): Tanz als Anthropologie. Paderborn, S. 14-30.